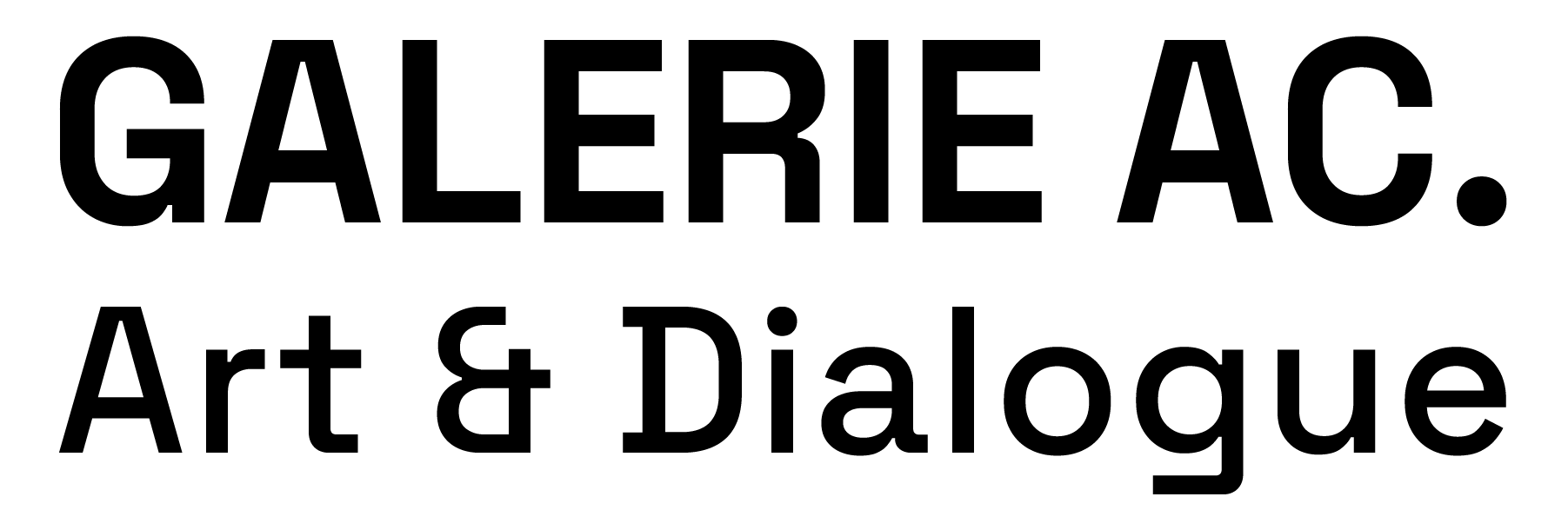AHMAD KADDOUR
Ahmad Kaddours Arbeiten wirken, als trügen sie die Sedimente der Geschichte in sich – Ablagerungen von Kulturen, die über Jahrhunderte hinweg einen Schichtungsraum der Wanderung, der Sprachen, Religionen und Politik sowie der Erfahrung von Vertreibung und Verlust gebildet und sich in Körper und Landschaft eingeschrieben haben. Ahmad Kaddour blickt unter die Haut der Geschichte, sowohl der großen als auch der individuellen Biografie.
Die Oberflächen seiner Werke sind rau, unregelmäßig, voller Brüche und Risse. Sie erscheinen durchleuchtet wie Röntgenaufnahmen, gleichen archäologischen Funden verwitterter Statuen, denen ihre schützende Hülle abhandenkam. Es sind Körper, die nun offenliegen, durchlässig sind für Sprache, für das, was sie geformt und geprägt hat. Diese Materialität spricht von Erosion – als Metapher für gesellschaftlichen und persönlichen Verlust, aber auch für Widerstandsfähigkeit.
Ahmad Kaddour stellt oft den menschlichen Körper ins Zentrum einer bild-poetischen Reflexion. Die fragmentierte Figur, überzogen mit Textstreifen, erzählt von Heimat, die entgleitet, von Selbstvergewisserung durch Sprache („Ich zähle meine Gliedmaßen und reiche nach meinen Fingerspitzen“ – ein intimer Akt des Sich-begreifen-Wollens). Zwischen Körper und Worten entsteht ein Raum, in dem Vergangenheit und Gegenwart ineinandergreifen. Es ist ein Körper im Zustand des Suchens, des Archivierens von Zugehörigkeit – ein Körper als Archiv.
Der Maler tritt als Bildsucher auf, der aus der Dunkelheit der Geschichte, aus dem Negativ der Welt, Bilder schöpft. Bei ihm verdichten sich Geschichte und Mythos, Schmerz und Hoffnung, Gegenwart und Erzählung. Es sind Bilder einer existenziellen Polyphonie, in denen persönliches und kollektives Gedächtnis, die Dringlichkeit der Kunst und die Frage nach innerer und äußerer Freiheit zusammenfallen.